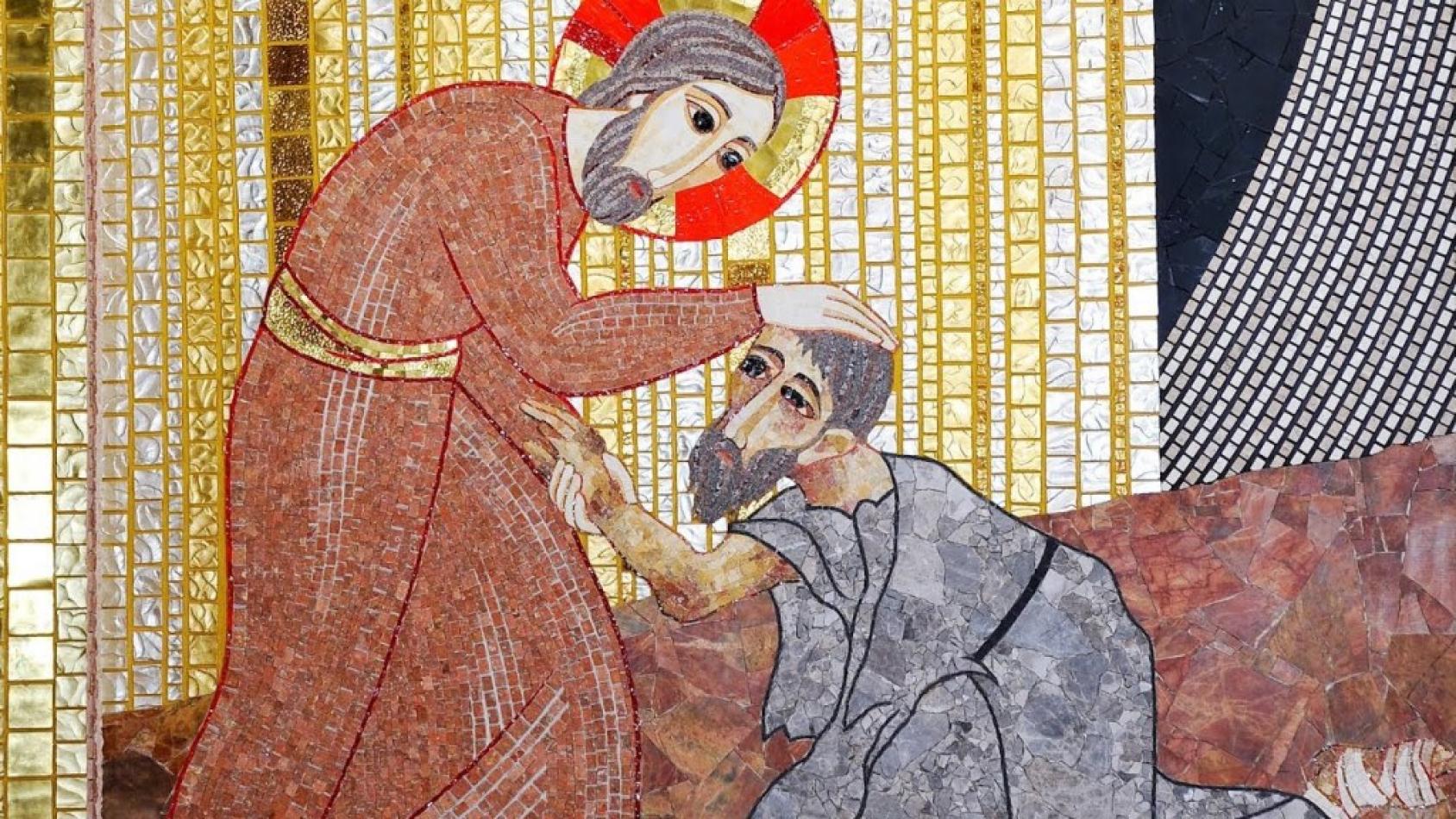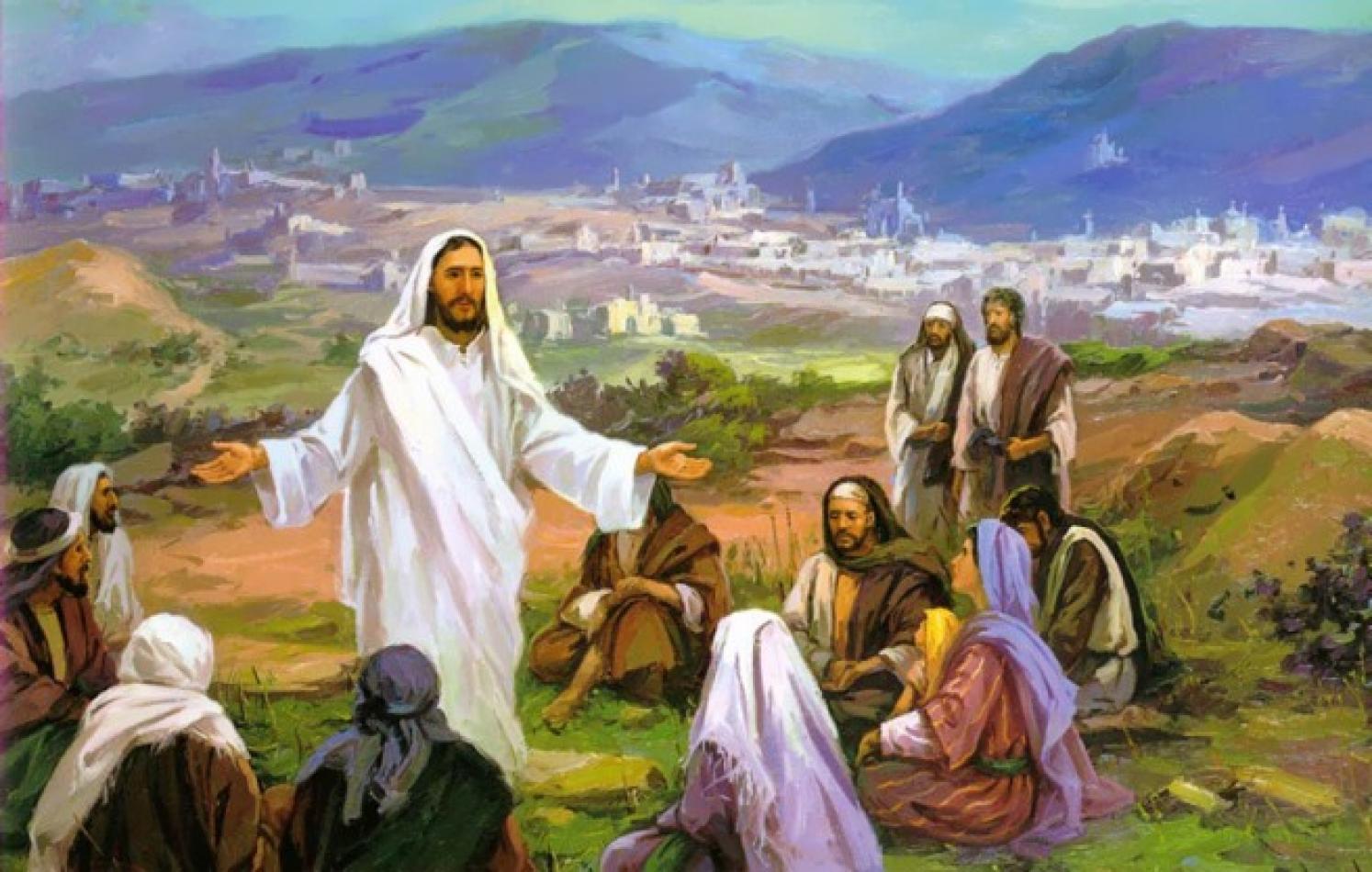Daniel Comboni
Comboni Missionare
Institutioneller Bereich
Andere Links
Newsletter
Zur Zeit Jesu verkörperten die Aussätzigen die Gestalt des absolut Ausgegrenzten. Auch andere Hautkrankheiten wurden oft allgemein als „Aussatz“ bezeichnet. Im mosaischen Gesetz (vgl. Levitikus 13–14) galt die Lepra nicht nur als körperliche Krankheit, sondern auch als rituelle Unreinheit. Der Priester hatte die Aufgabe, die Krankheit zu bestätigen. [...]
Geheilt … aber nicht gerettet!
„Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich gerettet.“
Lukas 17,11–19
Zur Zeit Jesu verkörperten die Aussätzigen die Gestalt des absolut Ausgegrenzten. Auch andere Hautkrankheiten wurden oft allgemein als „Aussatz“ bezeichnet. Im mosaischen Gesetz (vgl. Levitikus 13–14) galt die Lepra nicht nur als körperliche Krankheit, sondern auch als rituelle Unreinheit. Der Priester hatte die Aufgabe, die Krankheit zu bestätigen. Der Aussätzige wurde für „unrein“ erklärt und musste außerhalb der Gemeinschaft leben. Diese Isolation war nicht nur hygienisch, sondern auch religiös und sozial: man glaubte, der Aussatz sei ein Zeichen der Sünde oder eine göttliche Strafe. Sie lebten außerhalb der Dörfer, meist in Gruppen oder in Höhlen, und überlebten von der Barmherzigkeit und den Almosen, die man ihnen aus der Ferne zukommen ließ.
Geheilt, aber nicht gerettet
Als die Gruppe von weitem ruft: „Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!“, sagen die Aussätzigen nicht genau, was sie sich von ihm erhoffen – vielleicht nur eine Gabe oder ein Almosen. Doch als Jesus sie auffordert, sich den Priestern zu zeigen, verstehen sie, dass er sie heilen will. Denn es waren die Priester, die offiziell die Heilung bestätigen mussten. So machen sie sich – im Vertrauen auf Jesu Wort – auf den Weg.
Warum beklagt sich Jesus, sichtbar traurig und enttäuscht – was in seiner dreifachen Frage deutlich wird –, dass nur der Samariter zurückkehrt? Nicht, weil er Dank erwartete! Nein, Jesus erwartete, dass das Wunder als messianisches Zeichen erkannt würde (vgl. Mt 11,5; Lk 7,22), also dass eine wahre „Bekehrung“ geschähe, wie bei der Heilung Naamans des Syrers in der ersten Lesung: „Jetzt weiß ich, dass es keinen Gott gibt auf der ganzen Erde außer in Israel“ (2 Kön 5,15).
Man könnte sagen: Was haben die anderen neun falsch gemacht? Sie gehorchten doch Jesus und waren unterwegs zu den Priestern. Sie hätten Gott im Tempel gelobt, ein Opfer dargebracht, mit der Familie gefeiert und vielleicht später Jesus gedankt. Wo also lag ihr Fehler?
In Wirklichkeit ist nur der Samariter – der am stärksten Ausgeschlossene, als Häretiker verachtete – derjenige, der, wie die Samariterin am Brunnen, erkennt, dass die Stunde gekommen ist, da man den Vater weder auf dem Garizim noch in Jerusalem anbeten wird (Joh 4,21). Nur der Samariter „kehrt um“ und bekehrt sich. Jesus ist der neue Tempel, in dem Gott gepriesen wird, derjenige, der nicht nur den Körper heilt, sondern den Menschen in der Tiefe seines Wesens rettet. Die anderen neun sind geheilt, doch ihr Heilungsweg bleibt auf das Körperliche beschränkt. Sie bleiben an den alten Tempel und seinen Kult gebunden. Nur einer wird gerettet. Er gelangt zum Glauben und erkennt in Jesus den Messias. Deshalb sagt Jesus zu ihm: „Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich gerettet!“
Diese Episode ist wie ein Gleichnis, das auch unsere heutige Realität widerspiegelt. Wir alle wenden uns an Jesus, um Heilung von unseren Leiden zu erlangen, doch nur wenige schlagen den neuen Weg ein, den er weist. Wir bevorzugen die altbekannten Pfade – die, die uns nicht in Frage stellen.
Einige Gedanken zum Evangelium
1. Leben und Glaube unterwegs
Das Evangelium von heute ist voller Bewegung: nicht weniger als zehn Verben des Gehens und Handelns finden sich im Text. Es ist gewissermaßen ein Bild des Lebens selbst, verstanden als ein Weg, der von der Geburt bis zum Abschied aus dieser Welt führt. Vielleicht gibt es kein treffenderes Bild für den Lauf der menschlichen Existenz und Geschichte. Auch das Glaubensleben ist ein Weg, der mit der Taufe beginnt und – über viele, oft unerwartete Wege – zur himmlischen Heimat führt. Alles im Glauben wird „unterwegs“ gelebt und erfahren: Schritt für Schritt, mit Mühe und Ausdauer.
Die heutige Erzählung kann als Allegorie der Menschheit und des christlichen Glaubens gelesen werden. Zehn Aussätzige – eine Zahl, die die Gesamtheit symbolisiert. Alle zehn werden geheilt, beschenkt, aber nur einer wird durch den Glauben gerettet. Alle empfangen Gottes Gaben, doch nur wenige kehren zurück, um Gott zu preisen und verwandelt weiterzugehen. Wo keine Dankbarkeit ist, geht die Gabe verloren, sagt der Theologe Bruno Forte.
2. Ein Weg des „Dankes“
Leben und Glaube sind vor allem von der Unentgeltlichkeit geprägt: sie sind Geschenke. Damit diese Geschenke wachsen, bedarf es vieler liebevoller Hände. Deshalb ist „Danke“ eines der häufigsten Worte unseres Alltags. Es ist eine spontane Bewegung, auch wenn sie manchmal mechanisch wird. Danke zu sagen ist keine bloße Frage der Höflichkeit, sondern eine Lebenshaltung: Es bedeutet, das Dasein nicht als „Nehmen“, sondern als „Empfangen“ zu begreifen.
Wenn das schon im täglichen Leben gilt, dann umso mehr im Glauben. Der griechische Text sagt, der Samariter fiel Jesus zu Füßen und „dankte ihm“ – eucharistōn. In diesem Wort steckt charis (Gnade), wovon sich Eucharistie ableitet. „Danke“ zu sagen wird so zur Danksagung – zur Eucharistie.
In der Bibel begleitet der Dank jeden Schritt des Glaubenden: Jesus selbst handelt ständig im Dank an den Vater. Nach Paulus ist die Kirche berufen, ein Volk des überfließenden Dankes zu sein. In seinen Briefen finden wir unzählige Aufrufe, Gott allezeit und für alles zu danken: „Sagt Gott dem Vater Dank allezeit für alles“ (Eph 5,20).
3. Ein Leben ohne „Danke“ wird ungnädig – und unglücklich
Die jüdische Tradition sagt: „Wer irgendeine Gabe dieser Welt genießt, ohne zuvor ein Gebet oder einen Segen des Dankes zu sprechen, begeht ein Unrecht.“ Undankbarkeit macht uns unzufrieden, kritisch, nörglerisch, pessimistisch. Wir wechseln von der Logik des Geschenks und der Offenheit zu der der Gier, die fordert, beansprucht, misstraut…
Ein Leben ohne „Danke“ verliert seine Gnade, wird ungnädig – und schließlich unglücklich. Am Ende verwandelt es sich in eine Art „Hölle“: der Ort – oder besser, der Zustand – des Menschen, der die Gnade nicht erkennt, unfähig wird, das Geschenk zu empfangen, und sich weigert, zu danken.
4. „Wo sind die neun anderen?“
Das ist auch die Frage, die Jesus an uns richtet – an uns, die wir aus Gnade „da sind“, zurückgekehrt, um „Eucharistie“ zu feiern. Ich denke an die vielen, die sich vom Vater aller Gaben (Jak 1,17) entfernt haben, an unsere leeren Kirchen, an die suchenden Familien … Diese Frage anzunehmen heißt, den Mut und die Liebe zu haben, Jesus zu antworten: „Hier bin ich, auch in ihrem Namen, um dir zu sagen: Danke!“
Die Gnade und den Segen pflegen
Die Fähigkeit zu danken muss gepflegt werden. Hier eine Übung, um sie zu stärken:
Beginne jeden Morgen den Tag nicht durch die äußere Tür der Hektik – der Probleme, die zu lösen sind, der vielen Sorgen, die uns bedrängen –, sondern durch die innere Tür des Herzens: das Bewusstsein der Gabe eines neuen Tages, der Dankbarkeit und des Lobes. Dieser erste Schritt gibt dem Tag seinen Rhythmus und bestimmt seine Qualität und Farbe – grau oder lichtvoll.
Es gibt nämlich zwei völlig unterschiedliche Weisen, jeden Tag neu zu beginnen: den Tag gesegnet zu betreten und dankend zu beenden – oder ihn ohne Dank, „ungnädig“, zu durchschreiten.
P. Manuel João Pereira Correia, mccj