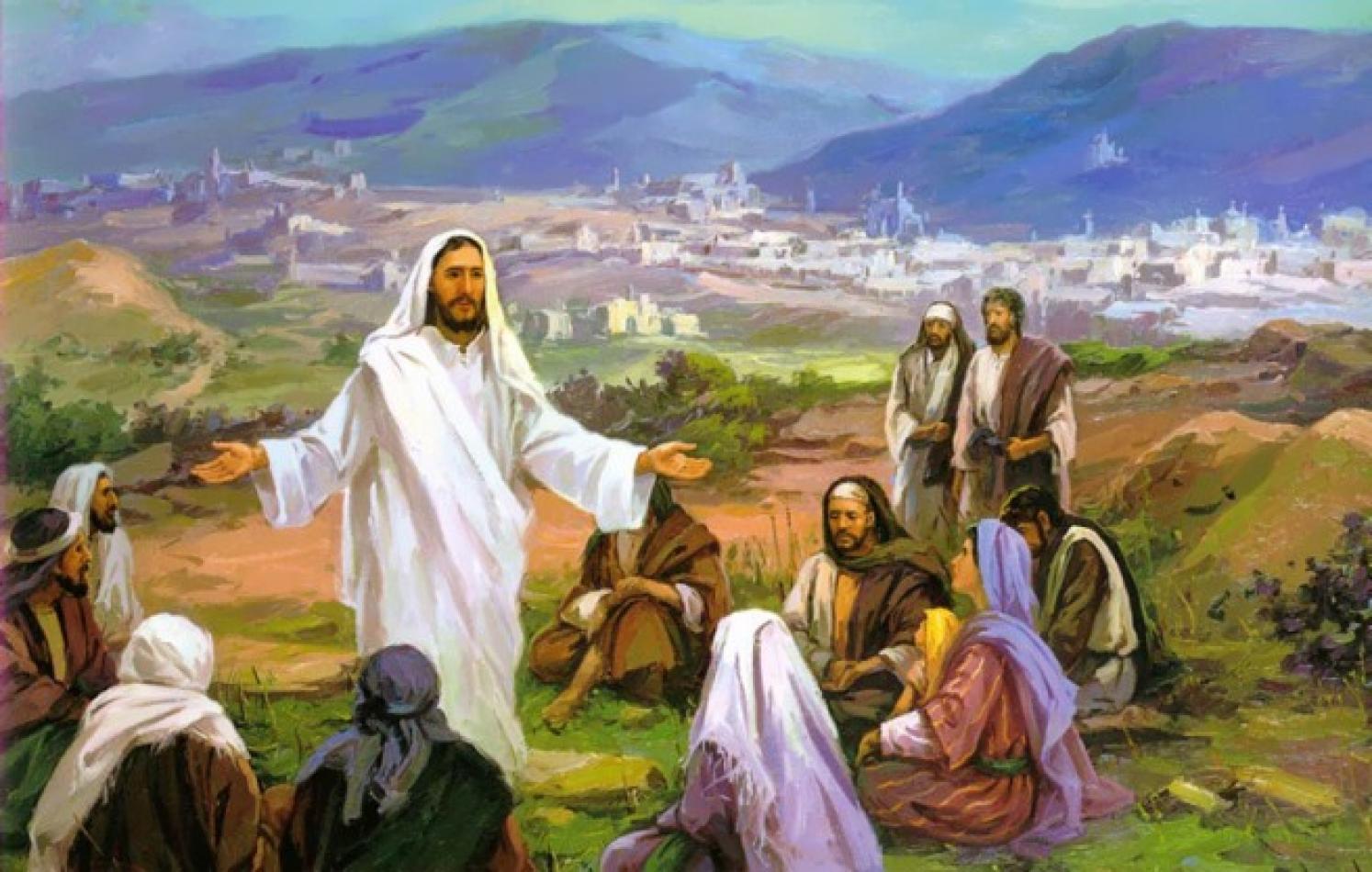Daniel Comboni
Comboni Missionare
Institutioneller Bereich
Andere Links
Newsletter
Drei Evangelientexte sprechen von Martha und Maria: Lukas 10,38–42; Johannes 11,1–46 und 12,1–8. Wir konzentrieren uns vor allem auf den Bericht des Lukas. Es scheint, als wolle Lukas die Einheit zwischen Tun („dem Nächsten werden“) und Hören („Gott nahe sein“) betonen.
MARTHA und MARIA
Tun oder Sein?
Der Kontext des Bethanien-Ereignisses ist aufschlussreich. Vorher erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das mit den Worten endet: „Geh und handle ebenso!“ (Lukas 10,37). Danach folgt unmittelbar die Lehre Jesu über das Vaterunser und das Gebet (Lukas 11,1–10). Es scheint, als wolle Lukas die Einheit zwischen Tun („dem Nächsten werden“) und Hören („Gott nahe sein“) betonen.
Drei Evangelientexte sprechen von Martha und Maria: Lukas 10,38–42; Johannes 11,1–46 und 12,1–8. Wir konzentrieren uns vor allem auf den Bericht des Lukas.
Nach dem vierten Evangelium lebten die beiden Schwestern in Bethanien, einem Dorf am Rande Jerusalems. Der hl. Johannes erwähnt sie stets gemeinsam mit ihrem Bruder Lazarus. Es scheint sich um eine wohlhabende Familie zu handeln. Sie sind Freunde Jesu und empfangen ihn und seine Gefolgschaft (vielleicht etwa dreißig Personen?), wenn er nach Jerusalem kommt. Dort kann Jesus ausruhen und „sein Haupt niederlegen“ (Matthäus 8,20). Bethanien ist das „Heiligtum“ der Freundschaft und der Gastfreundschaft.
Martha scheint die Ältere zu sein und die Herrin des Hauses. Ihr Name bedeutet wahrscheinlich „Herrin / Hausherrin“. Bei den Nabatäern ist der Name männlich, und im rabbinischen Talmud kann er männlich oder weiblich sein. Sie ist eine tatkräftige, fleißige Frau.
Maria wirkt jünger, zarter und introvertierter. Die Etymologie ihres Namens ist ungewiss: „rebellisch“, „geliebt“, „erhaben“…
Nach Lukas 10,38–42 nehmen Martha und Maria Jesus in ihrem Haus auf. Während Martha sich abmüht, das Essen für die Gäste vorzubereiten, setzt sich Maria zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Verärgert bittet Martha Jesus, ihrer Schwester zu sagen, sie solle ihr helfen. Doch Jesus antwortet unerwartet:
„Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, und das wird ihr nicht genommen werden.“
Dieser Ausspruch Jesu wurde auf viele Arten gedeutet – manchmal tendenziös oder ideologisch. Doch er kann uns helfen, über unsere Berufung als Jünger Jesu nachzudenken.
Unterwerfung oder Emanzipation?
EINE REVOLUTIONÄRE SICHT AUF DIE FRAU
Marias Verhalten – liebevoll, andächtig, still – wurde von manchen patriarchalen und klerikalen Strömungen idealisiert, die die Unterordnung der Frau unter den Mann vertreten.
Martha hingegen, eine Frau, die den Mut hat, „den Mund aufzumachen“ und ihre Persönlichkeit zu zeigen, gilt als Symbol der weiblichen Emanzipation. In einigen mittelalterlichen Darstellungen erscheint sie als weibliches Pendant zu hl. Georg oder hl. Michael, wobei sie den Drachen nicht tötet, sondern zähmt und an der Leine führt wie ein Haustier. Das ist eine weibliche Weise, das Böse zu besiegen – nicht durch Vernichtung, sondern durch Zähmung.
In Wirklichkeit ist auch Marias Figur revolutionär. Zu jemandes Füßen zu sitzen bedeutete, sein Jünger zu sein. Doch zur Zeit Jesu war das Studium der Tora den Männern vorbehalten. Im Hebräischen und Aramäischen existiert kein weibliches Wort für „Jünger“. Indem Jesus Marias Verhalten lobt, nimmt er eine provozierende Haltung ein und lehnt die patriarchale Mentalität ab. Ja, er stellt sogar in gewisser Weise das traditionelle Bild der „tugendhaften Frau“ in Frage, das Martha verkörpert, indem sie sich um den Haushalt kümmert (vgl. Sprüche 31,10ff).
Beide Frauen stehen daher für eine Form weiblicher Befreiung: Martha mit ihrer tatkräftigen Offenheit, Maria mit ihrer stillen Innerlichkeit. Zusammen sind sie ein Bild einer integrierten Menschlichkeit, in der Schweigen und Wort, Introversion und Extraversion miteinander leben.
Tun oder Beten?
DIE BEIDEN SCHWESTERN HEIRATEN!
Die Tradition sieht in Martha das Symbol des aktiven Lebens, in Maria das des geistlichen oder kontemplativen Lebens – letzteres als höherstehend. Der „leibliche Dienst“ sei dem „geistlichen Dienst“ untergeordnet (hl. Basilius). Das aktive Leben endet mit dieser Welt, das kontemplative setzt sich im ewigen Leben fort – so der hl. Gregor der Große. Doch er fügt hinzu, dass man „beide heiraten“ müsse – wie Jakob, der zwar Rahel (die schönere, aber unfruchtbare) liebte, aber zuerst Lea (weniger schön, aber fruchtbar) heiraten musste.
Die Gegenüberstellung von aktivem und kontemplativem Leben ist letztlich falsch, denn eines kann ohne das andere nicht bestehen. Sie schließen sich nicht aus, sondern ergänzen einander. Es geht um zwei wesentliche Dimensionen der Jüngerschaft. Martha und Maria gehören zusammen, wie Johannes deutlich macht, indem er sie stets gemeinsam erwähnt. Jesus liebt sie beide (Johannes 11,5). Im Übrigen ist es Martha, die Jesus entgegenläuft (während Maria im Haus bleibt) und ein beeindruckendes Glaubensbekenntnis ablegt (Johannes 11,20.27). Martha und Maria sind keine Gegensätze, sondern sich ergänzende Gestalten. Wir alle sind berufen, Martha und Maria in uns zu vereinen: Dienende und Hörende des Wortes zu sein.
Die beiden Schwestern leben in Versöhnung. So stellt sie der Dominikanisch Maler Fra Angelico in einem Fresko (in Florenz) dar. Beide erleben (geistlich) Jesu Todesangst im Garten mit. Während die drei Jünger schlafen, wachen sie versunken im Geheimnis. Maria liest das Wort, Martha hört es aufmerksam und zärtlich. Die beiden „Bräute“ leben in Frieden zusammen.
Gesetz oder Evangelium?
EINE KIRCHE IM HOCHZEITSKLEID UND MIT SCHÜRZE!
Man könnte auch annehmen, dass Lukas mit diesen beiden stilisierten Figuren zwei Dienste in der christlichen Gemeinde darstellen wollte: den „Tischdienst“ (Diakonie) und den Dienst am Wort (Prophetie). Als sich beides zu überschneiden beginnt, müssen die Apostel eine Wahl treffen: „Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen“ (Apostelgeschichte 6,2). Der Wortdienst scheint dem Liebesdienst überlegen.
Manche sehen in Martha und Maria zwei Phasen der Nachfolge. Martha, die sich um „viele Dinge“ sorgt, steht für die „erste Bekehrung“ – die Reinigung durch Werke. Maria, konzentriert auf das „eine Notwendige“, steht für die „zweite Bekehrung“ – die Reinigung des Herzens. In diesem Sinn wäre Martha das Bild des Alten Testaments (die Tora mit ihren 613 Geboten) und Maria das des Neuen Testaments (mit dem „Liebesgebot“, das alles zusammenfasst).
In Wahrheit verkörpern beide zwei gleich wichtige und wesentliche Dimensionen der Braut (der Kirche), die sich mit ihrem Bräutigam identifiziert, der „gekommen ist, um zu dienen“ (Markus 10,45). Die christliche Gemeinschaft also – herrlich in ihrem Hochzeitskleid, „zur Rechten des Königs“ sitzend (Psalm 45,10), aber ebenso bereit, ihr Kleid abzulegen, sich eine Schürze umzubinden und ihren Kindern die Füße zu waschen (Johannes 13,4).
Tun oder Sein?
DAS DOPPELGEBOT DER LIEBE
Der Kontext des Bethanien-Ereignisses ist aufschlussreich. Vorher erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das mit den Worten endet: „Geh und handle ebenso!“ (Lukas 10,37). Danach folgt unmittelbar die Lehre Jesu über das Vaterunser und das Gebet (Lukas 11,1–10). Es scheint, als wolle Lukas die Einheit zwischen Tun („dem Nächsten werden“) und Hören („Gott nahe sein“) betonen.
Wenn der barmherzige Samariter ein Bild der Nächstenliebe ist, so ist Bethanien ein Bild der Gottesliebe. Marta „tut“, Maria „liebt“. Das Salbungs-Ereignis in Bethanien, wie es Johannes erzählt, bestätigt diese Lesart. Jesus verteidigt Maria gegen Judas, der ausgerechnet mit dem Argument der Armenfürsorge ihre Handlung kritisiert (Johannes 12,8).
Fazit?
UMKEHR UND UNTERSCHEIDUNG
Martha und Maria erscheinen immer „im Haus“. Das Haus und das Dorf stehen für das normale Leben – die „Hauskirche“. Die alltägliche Lebensform des Christen, des Laien. Im Mittelpunkt stehen das Hören auf das Wort und der Dienst. Es geht darum, unser Zuhause zu einem „Bethanien“ zu machen: den Freund Christus aufzunehmen. Einen Menschen zu beherbergen verändert unsere Prioritäten und unser Handeln!
Martha und Maria lieben beide Jesus, aber sie setzen unterschiedliche Prioritäten. Maria richtet ihre Aufmerksamkeit ganz auf Jesus und genießt seine Gegenwart. Marta, mit ihren vielen Aufgaben beschäftigt, verfällt in Unruhe, Ungeduld und Erschöpfung. Und die Gegenwart Jesu wird für sie zur Last. Das ist das Problem.
In ihrer Gereiztheit ruft Jesus sie liebevoll (das Wiederholen des Namens „Marta, Marta“ ist zärtlich gemeint) zurück zum Wesentlichen – zur Umkehr zum „einen Notwendigen“, zur Suche nach dem Reich Gottes. Alles andere wird hinzugegeben (Lukas 12,31).
Die Zeit drängt, und der Jünger kann sich nicht mit „vielen Dingen“ aufhalten. Vielfalt im Dienst ist nicht gleichbedeutend mit dem „Dienst“, den Jesus erwartet. Es gilt, Prioritäten und Dringlichkeiten zu setzen. Anders gesagt: Es braucht Unterscheidung. Wie Paulus sagt:
„Ich bete darum, dass eure Liebe immer mehr wächst an Erkenntnis und aller Einsicht, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste ist“ (Philipper 1,9–10).
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
„Du machst dir viele Sorgen und verlierst dich in Vielerlei!“
„Eine Frau namens Marta nahm ihn gastlich auf.“
Lukas 10,38–42
Nach dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das uns am vergangenen Sonntag begegnete, stellt uns die Liturgie heute die Szene der Gastfreundschaft zweier Schwestern vor: Marta und Maria von Betanien. Der Kontext der Begebenheit in Betanien ist sehr aufschlussreich. Einerseits steht davor das Gleichnis vom „barmherzigen Samariter“, das mit den Worten endet: „Geh und handle genauso!“ (Lk 10,37). Andererseits folgt unmittelbar danach Jesu Lehre über das Vaterunser und das Gebet (Lk 11,1–10). Es ist offensichtlich, dass Lukas die Einheit von Tun (dem „Nächstenwerden“ für den Bruder) und Hören auf das Wort (dem „Gott-nahe-Sein“) hervorheben will.
In der ersten Lesung empfängt Abraham Gott, der ihm in der geheimnisvollen Gestalt von drei Männern begegnet: „Er blickte auf und sah drei Männer vor sich stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: ‚Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, geh nicht an deinem Knecht vorüber!‘“ (vgl. Gen 18,1–10).
Wir können sagen, dass Gastfreundschaft das zentrale Thema des heutigen Wortes Gottes ist. Gastfreundschaft ist eine der großen Lebensmetaphern. Empfangen im Mutterleib, in einer Familie und Gesellschaft aufgewachsen, lernen wir, selbst Gastgeber zu werden – Nächste für andere und für jedes Leben.
Die Heilige Schrift ist eine Geschichte der Aufnahme: vom Anfang im irdischen Paradies (Genesis), bis zur endgültigen Aufnahme im himmlischen Paradies (Offb 21–22), in das neue Jerusalem, dessen Tore „niemals geschlossen werden“ (21,25). Dort wird die vollkommene und ewige Aufnahme Wirklichkeit: „Siehe, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen“ (21,3). In der Mitte der Heilsgeschichte steht das Wort, das Fleisch wurde und „unter uns wohnte“ (Joh 1,14). Obwohl abgewiesen, hat Er nicht aufgegeben, sondern klopft seither an die Tür jedes Menschen (vgl. Offb 3,20).
Was bedeutet also Aufnahme im Leben eines Christen? Das ist es, was uns der Evangelist Lukas mit dieser Erzählung, die nur er überliefert, vermitteln will.
Zwei Frauen: ein Bild der Gastfreundschaft
Wer sind diese beiden Schwestern, Marta und Maria? Marta scheint die Ältere zu sein, die Herrin des Hauses. Sie ist eine tatkräftige und fleißige Frau. Maria hingegen erscheint jünger, sanft und nachdenklich.
Nach Lukas 10,38–42 empfangen Marta und Maria Jesus in ihrem Haus. Von ihrem Bruder Lazarus, der im Johannesevangelium stets mit ihnen verbunden ist, ist hier nicht die Rede. Auch nicht von der großen Schar, die Jesus begleitete. Der Evangelist lenkt bewusst den Blick auf die beiden Schwestern und ihre Haltung gegenüber Jesus. Während Marta sich abmüht, die Gäste zu bewirten, sitzt Maria zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Verärgert bittet Marta Jesus, Maria solle ihr helfen. Doch Jesus antwortet überraschend: „Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich in Vielerlei. Nur eines aber ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das wird ihr nicht genommen werden.“
Diese Aussage Jesu wurde oft so verstanden, als stelle sie das kontemplative Leben über das tätige Leben, das Gebet über das Handeln. Der „leibliche Dienst“ sei dem „geistlichen Dienst“ unterlegen, meint etwa Basilius der Große. Doch das ist sicherlich nicht Jesu Absicht. Gebet und Tat gehören untrennbar zusammen. Sie schließen sich nicht aus, sie widersprechen sich nicht, sondern ergänzen einander. Es geht um zwei grundlegende Dimensionen der Jüngerschaft. Marta und Maria sind keine Gegensätze, sondern Ergänzungen. Wir alle sind gerufen, Marta und Maria in uns zu vereinen: Dienende und Hörende des Wortes zu sein. Was also will Jesus sagen?
Aufnahme bedeutet Hören
„Jesus kam in ein Dorf, und eine Frau namens Marta nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester namens Maria, die sich dem Herrn zu Füßen setzte und seinem Wort zuhörte.“
Zunächst sollten wir das Neue und Provokante dieser Szene erkennen. Jesus durchbricht die gesellschaftlichen Konventionen seiner Zeit, indem er die Einladung von Frauen annimmt – damals ein anstößiges Verhalten. Zudem nimmt Maria eine revolutionäre Haltung ein. Zu den Füßen eines Rabbis zu sitzen bedeutete, sein Jünger zu sein. Doch zur Zeit Jesu war das Studium der Tora den Männern vorbehalten. „Es ist besser, die Tora zu verbrennen, als sie einer Frau zu überlassen“, sagten manche Rabbiner (vgl. F. Armellini). Auch Paulus war noch geprägt von dieser kulturellen Mentalität, wie seine Mahnungen an die Gemeinde von Korinth zeigen, heute unvorstellbar: „Die Frau soll in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihr nicht gestattet zu reden“ (vgl. 1 Kor 14,34–35).
„Marta aber war ganz mit dem Dienen beschäftigt. Sie trat zu Jesus und sagte: ‚Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, die Arbeit zu tun? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!‘“
Marta und Maria lieben beide Jesus, doch sie setzen unterschiedliche Prioritäten. Maria richtet ihre Aufmerksamkeit auf Jesus und genießt seine Gegenwart. Marta hingegen ist von den vielen Aufgaben überfordert und lässt sich von Unruhe, Ungeduld und Erschöpfung beherrschen. Jesu Gegenwart wird für sie zur Last. Genau darin liegt das Problem.
„Der Herr aber antwortete: ‚Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich in Vielerlei. Nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das wird ihr nicht genommen werden.‘“
Jesu zärtlicher Ruf („Marta, Marta“) lädt Marta zur Umkehr ein – zur Rückkehr zum Wesentlichen, zur Suche nach dem „einen Notwendigen“, dem Reich Gottes. Alles andere wird ihr hinzugegeben (vgl. Lk 12,31).
Die Vielfalt der Aufgaben ist nicht automatisch das „Dienen“, das Jesus von uns erwartet. Es braucht also Unterscheidung der Prioritäten und der wirklichen Notwendigkeiten. Wie Paulus sagt: „Ich bete darum, dass eure Liebe immer mehr wächst in Erkenntnis und allem Feingefühl, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt“ (Phil 1,9–10).
Wie oft tappen auch wir in die Falle des Aktivismus. Wir füllen unsere Kalender mit zahllosen Terminen. Und manchmal, überwältigt von „Dringlichkeiten“, vernachlässigen wir das wirklich Wichtige. Unser Tagesziel scheint oft zu sein, „alles geschafft zu haben“ – was selten gelingt – und hinterlässt ein bitteres Gefühl von Unzufriedenheit oder gar Frustration.
Vielleicht sollten wir bewusst das Gegenteil üben: niemals „alles“ erledigen wollen, sondern immer etwas für den nächsten Tag lassen – es dem Herrn anvertrauend, der wirkt, während wir schlafen. Dann würden wir erfahren, wie wahr das Psalmwort ist: „Vergeblich ist es, früh aufzustehen und sich spät zur Ruhe zu begeben und das Brot der Mühsal zu essen: Dem Seinen gibt er es im Schlaf“ (Ps 127,2).