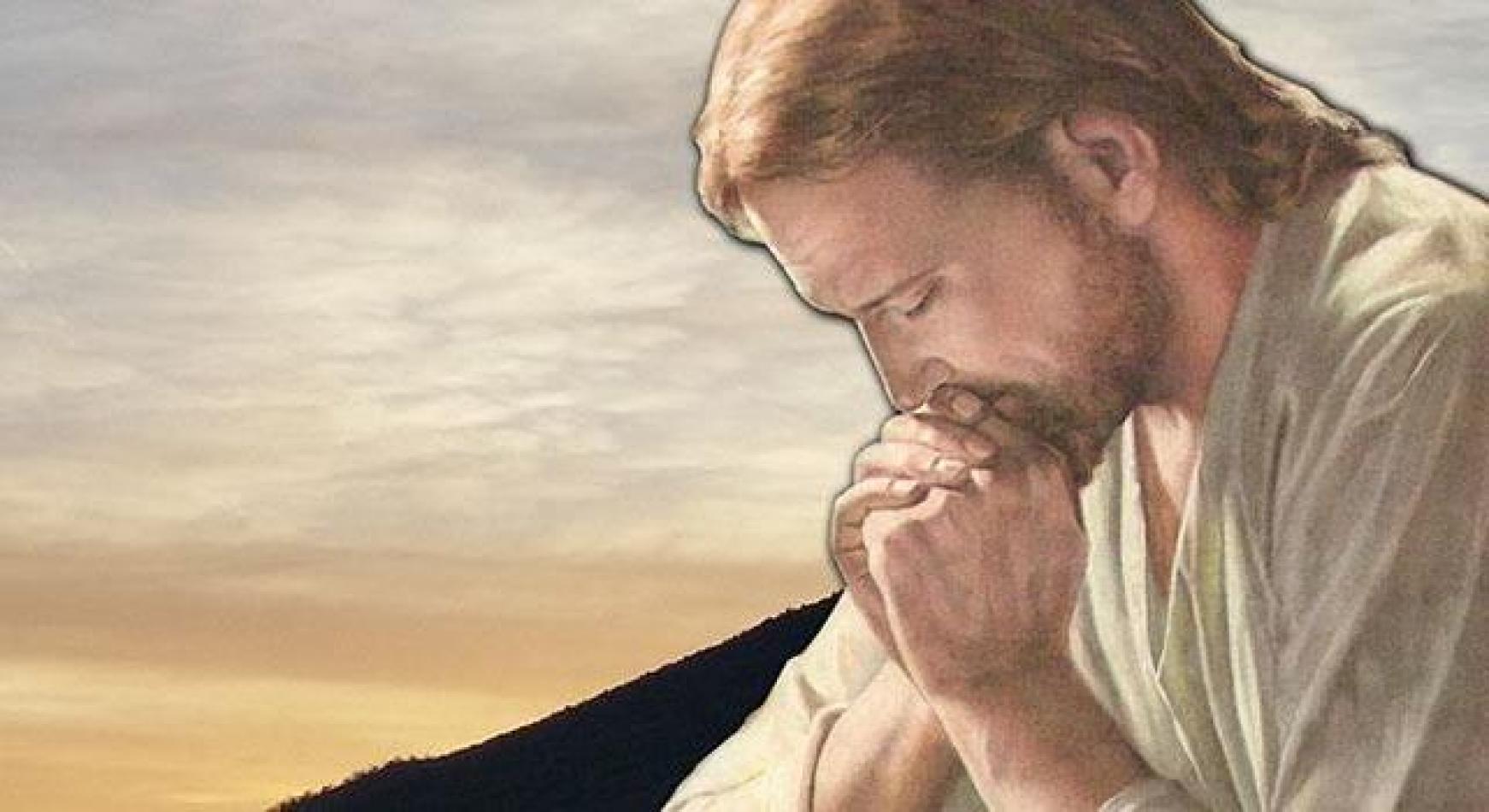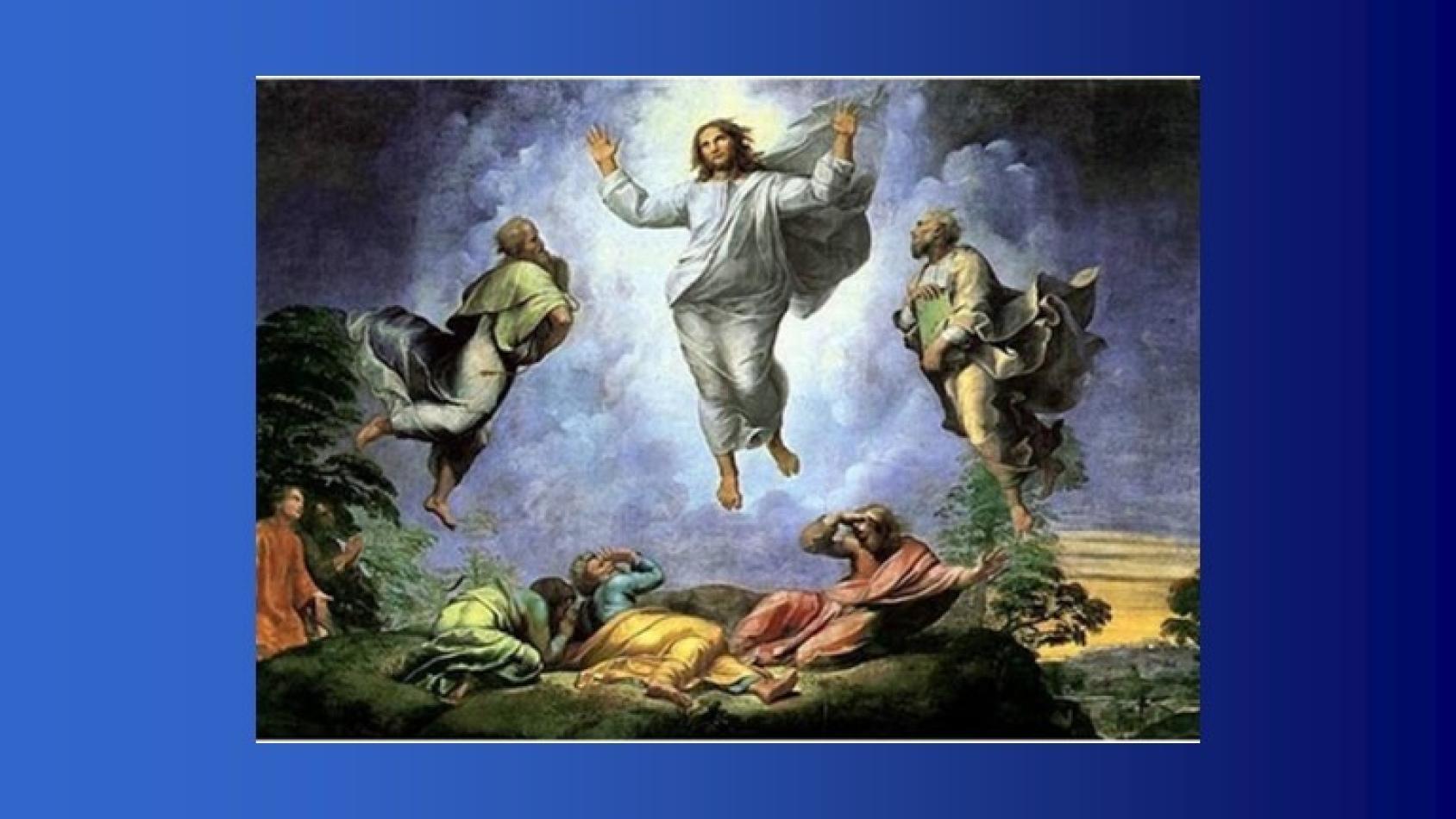Daniel Comboni
Comboni Missionare
Institutioneller Bereich
Andere Links
Newsletter
Das Evangelium dieses Sonntags bietet uns die lukanische Version des Vaterunsers. Wir kennen auswendig die Version aus dem Matthäusevangelium, die in sieben Bitten gegliedert ist (Mt 6,9–13). Die lukanische Fassung ist kürzer und enthält nur fünf Bitten. Dennoch ändert diese Unterschiedlichkeit nichts am Wesentlichen. [...]
„Herr, lehre uns beten.“
Lukas 11,1–13
Das Evangelium dieses Sonntags bietet uns die lukanische Version des Vaterunsers. Wir kennen auswendig die Version aus dem Matthäusevangelium, die in sieben Bitten gegliedert ist (Mt 6,9–13). Die lukanische Fassung ist kürzer und enthält nur fünf Bitten. Dennoch ändert diese Unterschiedlichkeit nichts am Wesentlichen.
„Jesus betete einmal an einem Ort; und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten.“ Dieser anonyme Jünger steht stellvertretend für uns alle. Jesus in innigem Gebet zu sehen, weckt in uns den Wunsch, an seiner tiefen Beziehung zum Vater teilzuhaben – gerade wir, die wir das Beten oft als mühsam empfinden.
Der Evangeliumstext besteht aus drei Teilen:
– das Gebet Jesu und das Vaterunser (Verse 1–4),
– das Gleichnis vom aufdringlichen Freund (Verse 5–8), das uns ermutigt, nicht müde zu werden im Gebet,
– und schließlich der Vergleich mit der Vater-Kind-Beziehung (Verse 9–13), der in uns das kindliche Vertrauen wecken soll: „Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst – wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!“
Gott – Vater oder Stiefvater?
Jesus spricht aus seiner Erfahrung als Sohn. Aber warum ist unsere Erfahrung oft so anders? Manchmal – unbewusst – glauben wir, der himmlische Vater sei strenger als unser irdischer Vater. Voltaire schrieb: „Niemand möchte Gott als irdischen Vater haben“, und Friedrich Engels folgerte: „Wenn ein Mensch einen Gott kennt, der härter und grausamer ist als sein Vater, wird er Atheist“ (Zitate nach Enzo Bianchi).
Woher kommt dieses tragisch verzerrte Gottesbild? Vielleicht aus Enttäuschungen im Gebet? Und sind diese nicht oft Folge eines falschen Verständnisses von Gebet? Viele unserer Gebete sind eigentlich Bitten um… „Wunder“! Wunder zu erbitten ist erlaubt, aber riskant! Die Schrift sieht darin eine mögliche „Versuchung Gottes“ (vgl. Lk 4,12), denn man reduziert Gott auf ein Götzenbild – und Götzen enttäuschen immer!
Das Gebet ist hingegen der höchste Ausdruck von Glaube, Hoffnung und Liebe. Wenn es mit Vertrauen, Hoffnung und kindlicher Liebe gesprochen wird, dann geschieht das Wunder – nicht so sehr im Außen, sondern in unserem Inneren – durch das verwandelnde Wirken des Heiligen Geistes.
Einige Gedanken zum Vaterunser
Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme
„Vater“ ist ein Gottesname, der in vielen Religionen verwendet wird. Die christliche Originalität liegt in der Gewissheit, „Kinder im Sohn“ zu sein. Die Natur dieses Gebets – im Plural formuliert – ist zutiefst missionarisch, denn das „wir“ umfasst nicht nur die christliche Gemeinde, sondern die ganze Menschheit.
An erster Stelle bitten wir um die Heiligung des Namens Gottes – und zwar in uns: „Ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen“ (Lev 22,32). Jeder von uns kann ein Ort sein, an dem Gottes Name geheiligt wird, indem wir seine Vaterschaft offenbaren – oder eben entweiht.
Die zweite Bitte gilt dem Kommen des Reiches Gottes. Dieses Verlangen war zur Zeit Jesu besonders stark. Im Neuen Testament erscheint der Ausdruck „Reich Gottes“ 122 Mal – 90 Mal auf den Lippen Jesu (F. Armellini). Reich Gottes und Evangelium sind in der Verkündigung Jesu untrennbar miteinander verbunden (vgl. Mk 1,15). Die Kinder des Reiches sind der Sauerteig für „neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt“ (2 Petr 3,13).
Gib uns Tag für Tag das tägliche Brot
Die demütigste Bitte steht im Zentrum des Vaterunsers: die dritte der fünf Bitten bei Lukas, die vierte der sieben bei Matthäus. Vielleicht ist das kein Zufall. Im Teilen des Brotes offenbart sich unser Bewusstsein von Kindschaft und Geschwisterlichkeit.
Zur Zeit Jesu hatte das Brot einen hohen symbolischen Wert: Es galt als heilig. Es wurde vom Familienoberhaupt gesegnet, dann mit den Händen zerbrochen und verteilt – nie mit einem Messer. Es war der höchste Ausdruck familiärer Gemeinschaft.
Um tägliches Brot zu bitten, bedeutet, anzuerkennen, dass alles vom Vater kommt. Es bedeutet auch ein tiefes Bewusstsein der Geschwisterlichkeit: Wer das Vaterunser betet, bittet für uns, nicht nur für sich selbst. Zudem ruft diese Bitte zur Bescheidenheit und erinnert an das Manna in der Wüste: Es durfte nur für den Tag gesammelt werden – wer hortete, erlebte Fäulnis (Ex 16,19–21).
Wir leben in einer Welt, in der soziale Ungleichheiten dramatisch und unerträglich geworden sind. Eine neue Studie der NGO Oxfam hat kürzlich gezeigt, dass vier afrikanische Milliardäre mehr als die Hälfte des Reichtums des Kontinents besitzen. Heute braucht es prophetische Stimmen wie die des heiligen Johannes Chrysostomus – und vieler anderer Kirchenväter –, die zu rufen wagten: „Der Reiche ist ein Dieb oder der Erbe von Dieben!“ Deshalb ist die Bitte um das tägliche Brot die revolutionärste und unbequemste des Vaterunsers.
und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung
Die Bitte um Vergebung ist die authentischste Weise, sich Gott zu nähern. Wir bitten um Vergebung für unsere Sünden – meine, unsere und die der ganzen Menschheit. Diese Bitte setzt ein lebendiges Sündenbewusstsein voraus – was nicht selbstverständlich ist – und eine ständige, ehrliche Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Auch wir gleichen oft den Pharisäern: Wir sind geschickt darin, „Mücken auszuseihen und Kamele zu verschlucken“ (Mt 23,24), beichten kleine Fehler und ignorieren große Ungerechtigkeiten, an denen wir mitverantwortlich sind.
Mit der Bitte um Vergebung ist die Bitte verbunden, nicht in Versuchung geführt zu werden. Aber welche Versuchung ist gemeint? Das griechische Wort kann auch „Prüfung“ bedeuten. Prüfungen gehören zum Weg des Glaubens – sie können läutern, aber auch gefährlich werden. Deshalb bitten wir den Vater um seine Hilfe. Es gibt außergewöhnliche Prüfungen, aber auch alltägliche, die besonders hinterlistig sind. Manchmal reicht die Monotonie des Lebens, der Stress des Alltags oder schlicht das Vergehen der Zeit, um den Eifer zu dämpfen und den Glauben erkalten zu lassen.
Im Vaterunser ist die „Versuchung“ oder „Prüfung“ im Singular genannt. Um ihren Sinn zu verstehen, können wir auf die Erfahrung Jesu schauen. Er durchlebt zwei entscheidende Prüfungen: in der Wüste, wo er zwischen dem Wort Gottes und der Logik der Welt wählen muss, und in der Passion, besonders in Getsemani, wo er einem erschütternden und geheimnisvollen Antlitz Gottes begegnet – dem Kreuz. Diese beiden Prüfungen sind verschieden, aber zutiefst miteinander verbunden: Beide stellen die Treue zur Sendung gemäß der Logik des Reiches Gottes auf die Probe.
Die Prüfung, von der im Vaterunser die Rede ist, betrifft also nicht nur die alltäglichen Versuchungen. Es ist die Prüfung des Jüngers, des Missionars, der das Reich Gottes zu seinem Hauptanliegen gemacht hat – zum Sinn seines Lebens. (Bruno Maggioni)
Zur persönlichen Betrachtung
Diese überraschende und außergewöhnliche Aussage Jesu betrachten und im Herzen verinnerlichen: „Darum sage ich euch: Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.“
P. Manuel João Pereira Correia, mccj