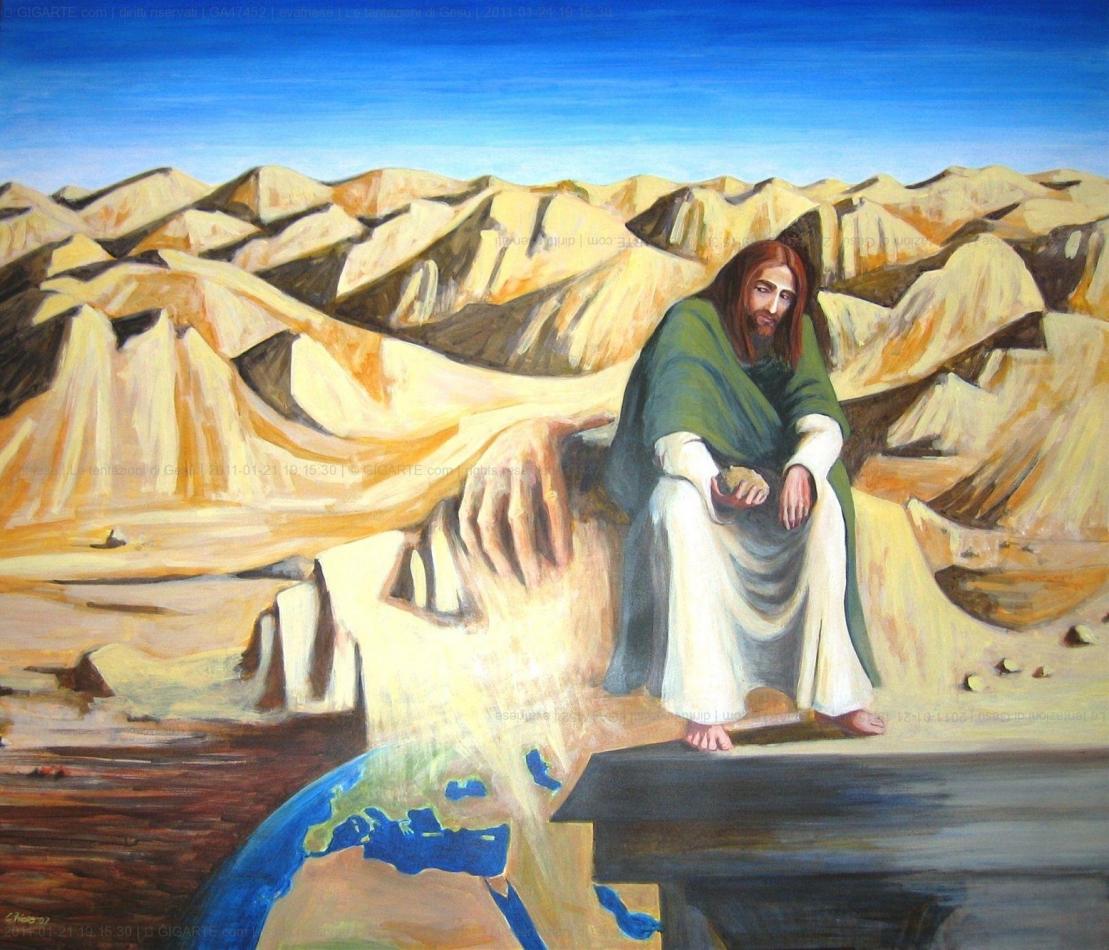Daniel Comboni
Comboni Missionare
Institutioneller Bereich
Andere Links
Newsletter
An diesem 30. Sonntag setzt Jesus seine Lehre über das Gebet fort. Am vergangenen Sonntag hat er uns mit dem Gleichnis vom ungerechten Richter und der armen Witwe gezeigt, WANN man beten soll: immer, ohne jemals müde zu werden. Heute zeigt er uns WIE man beten soll. Und er tut dies mit einem weiteren, uns wohlbekannten Gleichnis – dem vom Pharisäer und vom Zöllner. [...]
„Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt; wer sich aber erniedrigt, wird erhöht werden.“
Lukas 18,9–14
An diesem 30. Sonntag setzt Jesus seine Lehre über das Gebet fort. Am vergangenen Sonntag hat er uns mit dem Gleichnis vom ungerechten Richter und der armen Witwe gezeigt, WANN man beten soll: immer, ohne jemals müde zu werden. Heute zeigt er uns WIE man beten soll. Und er tut dies mit einem weiteren, uns wohlbekannten Gleichnis – dem vom Pharisäer und vom Zöllner.
Interessanterweise erscheint die Gestalt des Richters auch in den Lesungen dieses Sonntags wieder im Hintergrund. Vielleicht deshalb, weil wir uns so schwer von unserem Bild eines Richter-Gottes lösen können – eines Gottes, der uns für das Gute rechtfertigt oder für das Böse verurteilt?
Der Pharisäer und der Zöllner
Der Evangelist führt den Abschnitt ein, indem er Jesu Absicht klar benennt: Dieses Gleichnis war „für einige, die sich selbst für gerecht hielten und die anderen verachteten“.
„Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war Pharisäer, der andere Zöllner …“ Mit diesen Worten hat Jesus die beiden Figuren bereits deutlich gezeichnet.
Der Pharisäer gehörte einer religiösen Laienbewegung an (aktiv vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 1. Jahrhundert n. Chr.). Das Wort Pharisäer bedeutet wörtlich „der Abgesonderte“. In dem Bestreben, das Gesetz des Mose vollständig zu befolgen, hielten sie sich von anderen fern, um sich nicht zu verunreinigen. Sie galten als die „Reinen“, hoch angesehen wegen ihrer Frömmigkeit und ihres Gesetzeswissens.
Der Zöllner hingegen war ein Steuereinnehmer (vom lateinischen publicanus, abgeleitet von publicum = „Staatskasse“). Zöllner galten als Sünder und Unreine. Das Volk verachtete sie, weil sie mit den römischen Besatzern zusammenarbeiteten und die Armen ausnutzten.
Beide „steigen“ zum Tempel hinauf, um zu beten, und stellen sich vor Gott so dar, wie sie wirklich sind – denn Gott kann man nichts vormachen. Der Pharisäer spricht ein Dankgebet. Im Spiegel des Gesetzes sieht er sich selbst als gerecht und untadelig und ist mit sich zufrieden. Er ist nicht wie die anderen. Um sich herum sieht er nur Diebe, Ungerechte und Ehebrecher. Stolz richtet er sich auf und zählt vor Gott seine guten Werke auf – als würde er Bilanz ziehen. Er fühlt sich im Reinen mit seinen Konten, ja, er glaubt, Guthaben für den Himmel gesammelt zu haben. Heute würden wir sagen: der perfekte, makellose Christ mit garantiertem Eintritt ins Paradies.
Der Zöllner hingegen bleibt hinten stehen. Er wagt es nicht, sich dem Heiligen zu nähern. Die Last seiner Sünden beugt sein Haupt. Er weiß, dass er ein verstockter Sünder ist. Er bringt nur die Worte hervor: „O Gott, sei mir Sünder gnädig“, und schlägt sich an die Brust.
Jesus schließt das Gleichnis mit Autorität:„Ich sage euch: Dieser [der Zöllner, der um Erbarmen bat] ging gerechtfertigt nach Hause, nicht jener [der Pharisäer, der sich selbst für vollkommen hielt]. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt; wer sich aber erniedrigt, wird erhöht werden.“
Welcher der beiden bin ich?
Ich gestehe: Ich wäre gern wie der Pharisäer
Heute schaut jeder auf den Pharisäer herab und schlägt sich wie der Zöllner an die Brust. Ich habe Mitleid mit dem armen Pharisäer. Ich gestehe: Ich beneide ihn! Ich möchte so sein wie er – ein treuer Beobachter des ganzen Gesetzes! Perfekt, tadellos! Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, ihm nachzueifern – vergeblich! Tief in meinem Inneren würde ich mich, wie er, gern an meinem Leben erfreuen.
Es scheint mir, dass Jesus mit dem Pharisäer recht streng war und ihn in schlechtem Licht erscheinen ließ. Dabei begann sein Gebet doch gut, nämlich mit einem Dank. Ja, dann ließ er sich ablenken, schaute zurück (wem passiert das nicht?), und als er den Zöllner sah, konnte er seinen Groll gegen diesen Kollaborateur nicht zurückhalten – und glitt ins Urteil ab. Schade!
Die Versuchung, den Zöllner nachzuahmen
Da ich es nicht geschafft habe, wie der Pharisäer zu sein, bleibt mir nur, mir an die Brust zu schlagen und das Gebet des Zöllners zu wiederholen: „O Gott, sei mir Sünder gnädig.“
Aber ich frage mich, inwieweit ich wirklich die Haltung des überzeugten, reumütigen Sünders verinnerlicht habe. Im Grunde war er ein öffentlicher Sünder, ohne Ausweg. Ich hingegen bin ein Priester, der – zumindest theoretisch – ein Vorbild sein sollte. Es ist gar nicht so einfach, mit derselben Überzeugung wie der Zöllner zu beten und sich ganz auf Gottes Barmherzigkeit zu verlassen. Im selben Moment, in dem ich mich als Sünder bekenne, spüre ich die Versuchung, mich doch noch eine Stufe über meine Mitmenschen zu stellen. Sünder, ja – aber übertreiben wir nicht!
Zwei Zwillinge im Schoß des Herzens
Letztlich frage ich mich: Wer bin ich wirklich – der Pharisäer, der ich gern wäre, oder der Zöllner, der ich nicht sein möchte? Ach, ich glaube, ich trage beide in meinem Herzen, wie Zwillinge! Wie sollen sie zusammenleben? Am Ende müssen sie lernen, miteinander auszukommen.
Zu meinem Pharisäer sage ich ständig, er solle nicht nach Selbstgefälligkeit suchen, sondern danach, dem Vater zu gefallen. Meinem Zöllner wiederhole ich unaufhörlich, dass Gott ihn liebt, so wie er ist. Er muss sich die Liebe des Vaters nicht verdienen – sie ist ein Geschenk! Ja, gerade meine Armut und Schwäche ziehen die besondere Zuwendung Jesu auf sich, der für Zöllner und Sünder gekommen ist.
Werde ich beide erziehen können? Ich weiß es nicht – aber ich versuche es. Eines weiß ich: Erst wenn beide eins geworden sind, werde ich in das Himmelreich eingehen können!
Zur persönlichen Besinnung
Meditieren wir über einige Verse aus der ersten und der zweiten Lesung.
In der ersten lädt uns Jesus Sirach (35,15–22) ein, wie der Arme zu beten:
„Das Gebet des Armen dringt durch die Wolken; es kommt nicht zur Ruhe, bis es sein Ziel erreicht hat; es hört nicht auf, bis der Höchste eingegriffen hat, Gerechtigkeit für die Gerechten schafft und das Recht wiederherstellt.“
In der zweiten, Paulus – müde, alt und im Gefängnis – verabschiedet sich bewegend von seinem jungen Schüler Timotheus, indem er sich der Gerechtigkeit Gottes anvertraut:
„Mein Sohn, ich werde schon als Trankopfer dargebracht, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Nun liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird.“ (2 Tim 4,6–8.16–18)
Möge auch uns vergönnt sein, dies am Ende unseres Lebens sagen zu können!
P. Manuel João Pereira Correia, mccj