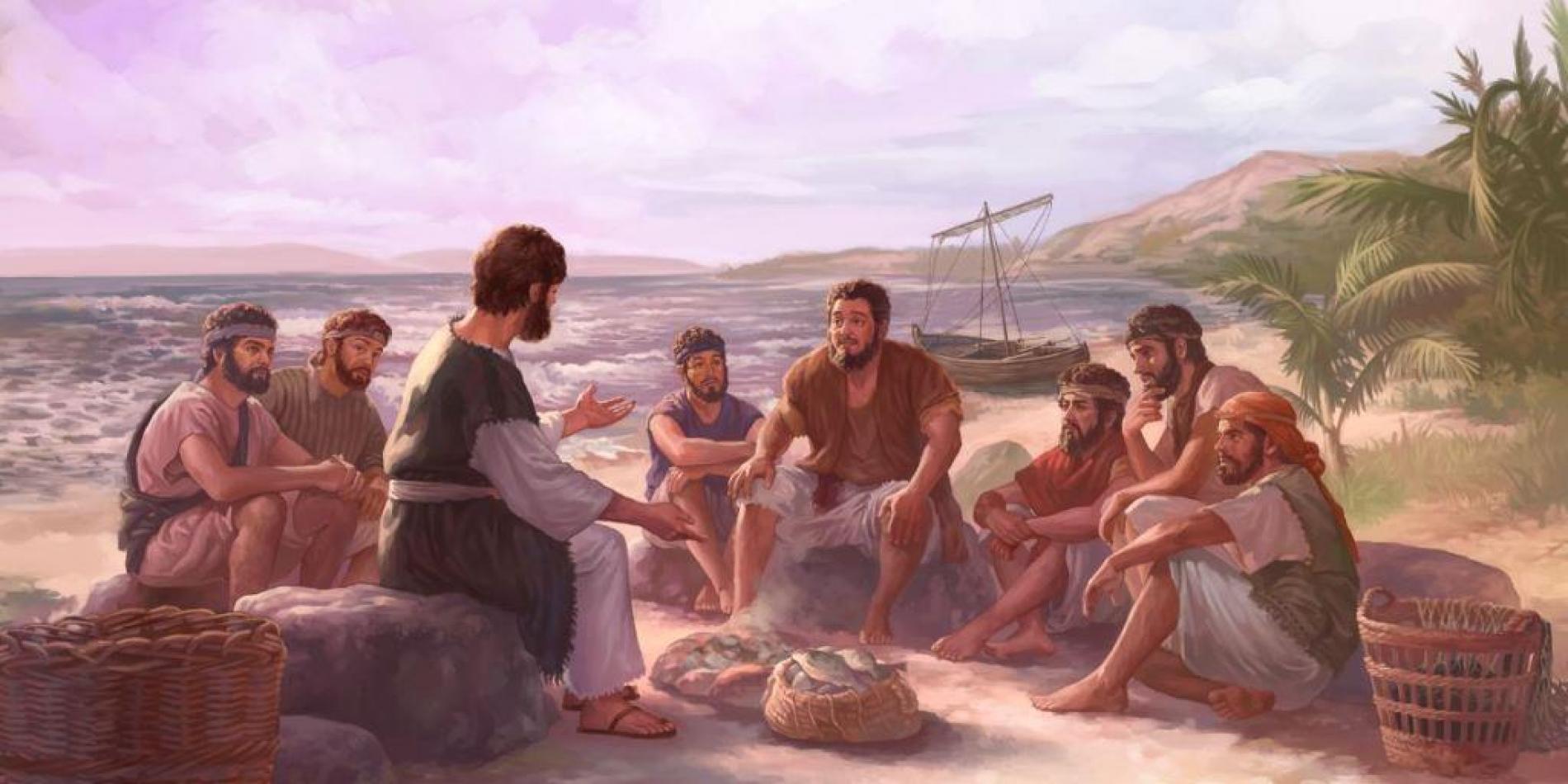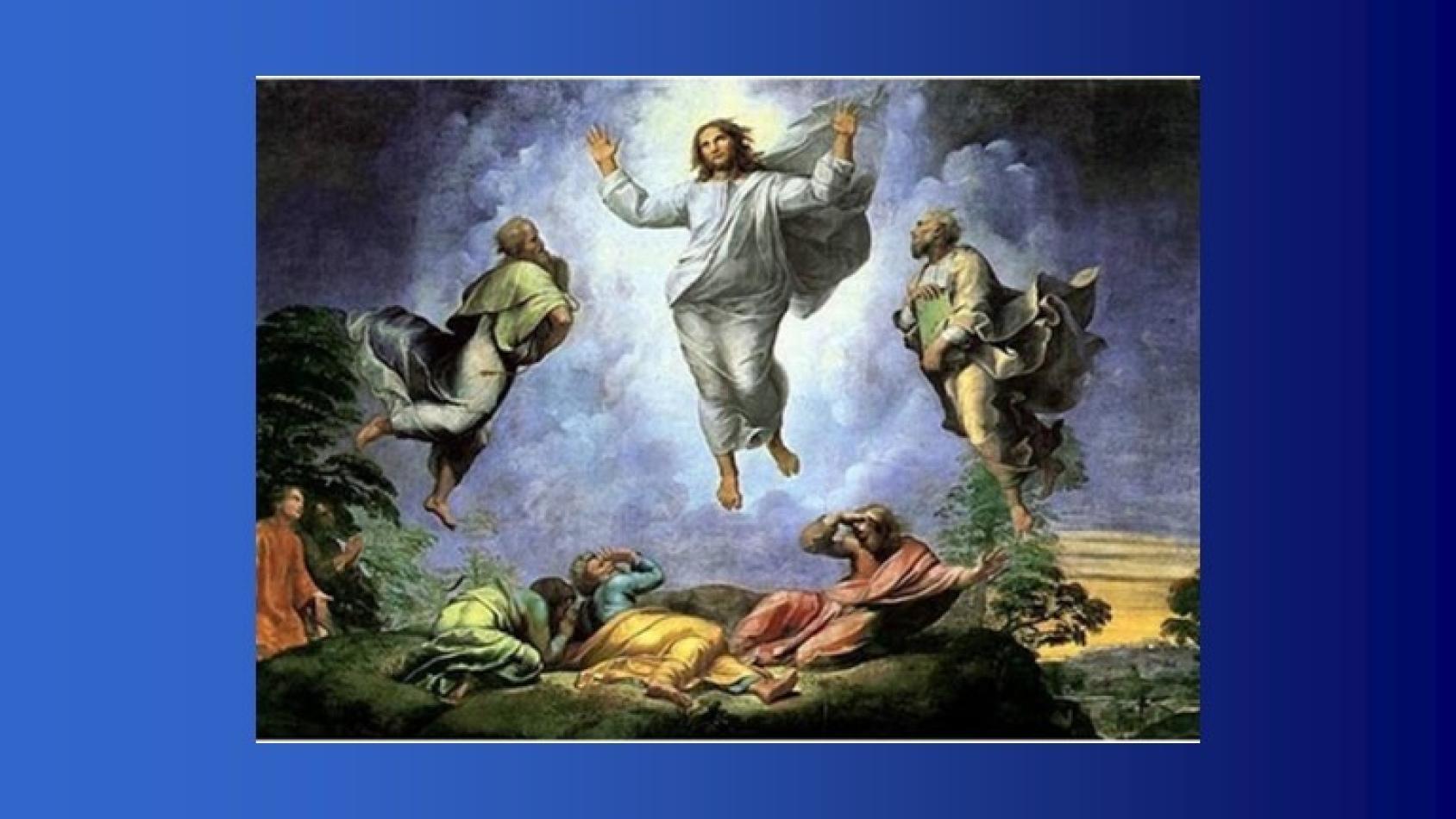Daniel Comboni
Comboni Missionare
Institutioneller Bereich
Andere Links
Newsletter
Letzten Sonntag erzählte uns der heilige Johannes von zwei Erscheinungen Jesu vor den Jüngern in Jerusalem, die sich an einem Sonntag ereigneten, während sie im Abendmahlssaal eingeschlossen waren. Heute präsentiert er uns eine Offenbarung Jesu in einem völlig anderen Kontext: Wir befinden uns nicht mehr in der Heiligen Stadt, sondern in „Galiläa der Heiden“, einem Land des unsicheren Glaubens; nicht mehr am Sonntag, sondern an einem gewöhnlichen Werktag, in einem weltlichen Umfeld. Der Auferstandene begegnet uns nicht nur im heiligen Raum der Kirche am Sonntag, sondern auch im Alltag, in der Arbeit, im Gewöhnlichen.
Johannes 21,1–19: „Es ist der Herr!“
Letzten Sonntag erzählte uns der heilige Johannes von zwei Erscheinungen Jesu vor den Jüngern in Jerusalem, die sich an einem Sonntag ereigneten, während sie im Abendmahlssaal eingeschlossen waren. Heute präsentiert er uns eine Offenbarung Jesu in einem völlig anderen Kontext: Wir befinden uns nicht mehr in der Heiligen Stadt, sondern in „Galiläa der Heiden“, einem Land des unsicheren Glaubens; nicht mehr am Sonntag, sondern an einem gewöhnlichen Werktag, in einem weltlichen Umfeld. Der Auferstandene begegnet uns nicht nur im heiligen Raum der Kirche am Sonntag, sondern auch im Alltag, in der Arbeit, im Gewöhnlichen.
Ein Arbeitstag
Alles beginnt mit der Initiative von Simon Petrus, der beschließt, fischen zu gehen. Seine Gefährten schließen sich ihm an: „Wir kommen auch mit.“ Man fragt sich: Was bedeutet diese Geste des Petrus? Ist sie vielleicht aus Langeweile geboren, aus Ratlosigkeit? Oder aus einem Gefühl der Orientierungslosigkeit, da sie sich nun ohne den Meister wiederfinden? Oder ist es eine Rückkehr in die Vergangenheit, ins frühere Leben, nach dem Einschub der drei Jahre mit Jesus? Auch wir können in ähnliche Situationen geraten. Nach einer leidenschaftlichen Erfahrung, die plötzlich endet und uns enttäuscht und orientierungslos zurücklässt, ist die Versuchung groß, alles zu vergessen und „zum früheren Leben zurückzukehren“.
Doch die Erzählung deutet auf etwas anderes hin. Der Evangelist fügt Elemente ein, die auf eine symbolische Bedeutung des Geschehens hinweisen. Es geht nicht um irgendeinen Fischfang, sondern um die ihnen anvertraute Mission: „Menschenfischer“ zu sein. Erwähnt wird das Boot des Petrus (Symbol der Kirche); die sieben Jünger (Symbol der Gesamtheit der christlichen Gemeinschaft, im Gegensatz zu den Zwölf, die Israel darstellen); das Meer (Symbol der lebensfeindlichen Kräfte); Tiberias, eine von Herodes Antipas zu Ehren des Kaisers Tiberius erbaute Stadt, halb heidnisch, von Jesus vermutlich nie besucht und als unrein geltend, da sie auf einem Friedhof errichtet wurde (F. Armellini).
Kurzum, eine Mission, die unserer heutigen sehr ähnelt. In diesem Boot, vertreten durch die sieben Jünger, sind auch wir – zusammen mit allen, die kämpfen, um die Welt vom Bösen zu befreien.
Eine Nacht der Frustration
„Aber in jener Nacht fingen sie nichts.“
Warum? Aus Unvermögen? Oder bestätigt es, dass wir ohne Ihn nichts tun können? Jeder von uns hat solche Erfahrungen gemacht: Frustration, das Gefühl der Nutzlosigkeit, den Eindruck, Zeit und Energie verschwendet zu haben... Reife – menschlich wie christlich – geht auch durch Zeiten der Prüfung. Unsere Lage ist die eines Arbeitens „in der Nacht“, ohne garantierte Ergebnisse.
Ein Morgengrauen der Hoffnung
Doch nach jeder Nacht bricht ein neuer Tag an, der Licht und Hoffnung in unser Leben bringt. Dieses Licht und diese Hoffnung kommen von dem „Unbekannten“, der am Ufer erscheint:
„Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer; doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.“ Vielleicht war er die ganze Nacht dort, aber ihre Augen konnten ihn nicht erkennen.
„Jesus sagte zu ihnen: ‚Kinder, habt ihr nichts zu essen?‘ Sie antworteten: ‚Nein.‘ Da sagte er zu ihnen: ‚Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden.‘ Sie warfen es aus und konnten es nicht mehr einholen wegen der Menge der Fische“: 153 große Fische, eine rätselhafte Zahl, die Fülle und vielleicht die Gesamtheit der zu rettenden Menschheit symbolisiert.
Jesus spricht sie liebevoll als „Kinder“ an. So spricht er auch heute zu uns, besonders in Momenten der Traurigkeit, Frustration und Entmutigung. Und er zeigt uns, wo wir das Netz auswerfen sollen: rechts, auf der richtigen Seite, die gute Seite, die in jedem Menschen existiert.
„Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: ‚Es ist der Herr!‘“
Petrus und Johannes sind die Hauptfiguren dieses Sonntags, so wie Thomas es am vergangenen war. Sie stehen einander nicht entgegen, sondern ergänzen sich: Sie repräsentieren Institution und Charisma, Tatkraft und Nachdenken, Handeln und Betrachtung. Beides sind Grundpfeiler unseres christlichen Lebens.
Ein Morgen des Trostes
„Als sie an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer mit Fisch darauf und Brot... Jesus sagte zu ihnen: ‚Kommt und esst!‘“
Die Begegnung mit dem Auferstandenen endet am Osterfeuer in einem Moment der Gemeinschaft. Die Einladung zum Essen ist ein Hinweis auf die Eucharistie. Brot und Fisch sind wiederkehrende christologische Symbole in der frühen Kirche.
Doch es lag etwas in der Luft jenes Frühlingsmorgens, das die Freude hemmte. Die Flammen dieses Feuers riefen Petrus die Geister jener Nacht ins Gedächtnis, als er, ebenfalls an einem Feuer, den Meister dreimal verleugnet hatte. Auch die anderen Jünger wagten es nicht, Jesus in die Augen zu sehen. Niemand hatte ein reines Gewissen. Jeden Moment erwarteten sie eine Rüge, eine Zurechtweisung von Jesus wegen ihrer Untreue. Doch nichts dergleichen geschah. Jesus löste mit großer Zartheit und liebevoller Sanftheit die dunkle Wolke, die über Simon Petrus schwebte.
„Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: ‚Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich (griechisch agapan) mehr als diese?‘ Er antwortete ihm: ‚Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe (philein).‘ Jesus sagte zu ihm: ‚Weide meine Lämmer.‘“
Jesus fragt mit dem Verb agapan, das eine totale, bedingungslose Liebe (Agape) meint, während Petrus mit philein antwortet, das eine Liebe des Herzens und der Freundschaft (Philia) ausdrückt. Beim dritten Mal passt sich Jesus der Liebe des Petrus an und verwendet selbst philein:
„‚Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?‘ Petrus wurde traurig, weil er ihn zum dritten Mal fragte: ‚Hast du mich lieb?‘, und sagte zu ihm: ‚Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe.‘ Jesus sagte zu ihm: ‚Weide meine Schafe.‘“
Petrus, der sich als unzuverlässig erwiesen hatte, wird das ganze Vertrauen geschenkt: Jesus übergibt ihm seine Herde. Er macht ihn zum Hirten – ein messianischer Titel, den Jesus bis dahin für sich selbst behalten hatte.
„Und nachdem er das gesagt hatte, sagte er zu ihm: ‚Folge mir nach!‘“
Folge mir, um der Hirte zu sein, der sein Leben für die Schafe gibt.
Ein wunderbares Modell des Trostes
Ich schließe mit einem schönen Kommentar von Kardinal Carlo Maria Martini:
„Das Verhalten Jesu ist ein wunderbares Modell des Trostes, das – über alle Schwächen hinweg – das Beste im Menschen erkennt.“
Der Auferstandene tadelt niemanden. Ja, er hatte die beiden Jünger von Emmaus und die Elf wegen ihres Unglaubens zurechtgewiesen, aber nie auf ihre Untreue oder ihren Verrat hingewiesen (Lk 24,25; Mk 16,14).
„Das ist wahrhaft königlicher Trost: nicht die Demütigung des anderen ausnutzen, um zu spotten, zu verurteilen oder auszuschließen, sondern wieder aufzurichten, neuen Mut zu geben, Verantwortung zurückzugeben. Um so zu trösten, muss man, denke ich, wie Jesus sein – also eine große Freude, einen großen Schatz in sich tragen, denn dann ist es leicht, ihn weiterzugeben. Der Herr, der den Schatz seines göttlichen Lebens besitzt, lässt den Trost tropfenweise wie Balsam herab. Und wir können – im Bewusstsein, mit ihm verbunden zu sein – den Trost tropfenweise weitergeben, ohne Vorwürfe oder Überheblichkeit.“
Und gerade wegen dieses Trostes verließen die Apostel, nachdem sie geschlagen worden waren, „voll Freude den Hohen Rat, weil sie gewürdigt worden waren, um des Namens Jesu willen Schmach zu erleiden“ (erste Lesung).